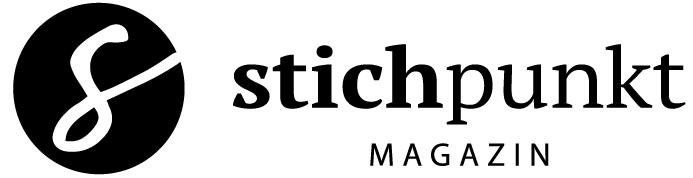In Beziehungen lebe ich Freiheit. Das heißt, ich bin nicht dafür begabt, anderen zu sagen, wie sie etwas zu tun oder was sie zu unterlassen haben. Ich kontrolliere andere nicht, und lehne umgekehrt ab, kontrolliert zu werden. Selbst beim kleinsten Versuch fühle ich mich eingeengt. Was noch schwerer wiegt, mich schmerzt das Misstrauen, das jeder Kontrolle zugrunde liegt. Allgemeinhin wird behauptet, dass Menschen mehrheitlich so seien, dass sie kein gutes Gefühl dabei haben, wenn sie mit Argusaugen bewacht werden. Es ist mir längst klar, dass das ein Irrtum ist. Nicht nur einmal habe ich erlebt, dass Männer, mit denen ich in einer Partnerschaft lebte, sich beschwerten, dass ich ihnen so viel Freiraum gebe. So fremd es mir auch ist, aber sie verlangten nach mehr Kontrolle. Die ich ihnen nicht geben konnte. Und auch nicht wollte.
Auch gesellschaftlich ist das weit verbreitet: Selbst wenn, metaphorisch gesprochen, die Kette abgelegt wird, an der man angehängt war, bewegen sich die meisten Menschen nicht in die Freiheit, sondern bleiben immer noch wie angekettet stehen. Wahrscheinlich ist es ein Mythos, zu glauben, im Grunde wollten alle frei sein. Für die physisch Eingesperrten mag das gelten, aber aus den inneren Gefängnissen, aus denen, die man nicht sieht, brechen die wenigsten aus. Man etabliert in sich selbst ein Überwachungs- und Kontrollsystem beziehungsweise übernimmt das durch Erziehung internalisierte. Das heißt auch, es fühlt sich ziemlich vertraut an, wenn ein adäquates System im Außen aufgebaut wird. Wenn also der Partner in einen Kontrollwahn verfällt. Oder die Regierenden.
Es ist nun mal so: Überwachung, also Kontrolle, lässt die meisten Menschen ziemlich kalt. Sie haben sich daran gewöhnt. Oder sie argumentieren, man könne sie ruhig kontrollieren, sie hätten nichts zu verbergen. Es gibt keinen Aufschrei. Es ist in Ordnung. Man trägt sogar das Gerät, mit dem man überwacht werden kann, ständig mit sich, man bewegt sich in sozialen Netzwerken und überantwortet sich damit freiwillig den dortigen Kontrollorganen. Auch ich tue das, begleitet von einem großen Unbehagen, nicht immer, aber völlig aus dem Bewusstsein gerät es nie. Bisweilen hadere ich mit mir, überlege, mich von Smartphone und Co ganz zu verabschieden; inzwischen nutze ich es weniger und lasse es immer öfter in der Schublade, wenn ich unterwegs bin. Zwischendurch ärgere ich mich über mich selbst, dass mir der finale Schritt noch nicht gelungen ist. Bis dahin muss ich mit dem inneren Widerspruch leben.
Nochmal: Ich will keine Kontrolle. Mir erscheint in diesen Zeiten besonders wichtig, sich dagegen zu wehren. Man denke nur daran, dass es bereits möglich ist, sich Chip-Implantate unter die Haut setzen zu lassen. Der gläserne Mensch. Durchleuchtet, dauerüberwacht. Mächtigen kann nichts Besseres passieren, um ihre Befugnisse weiter auszubauen. Wie man dahin findet, hat unter anderem Jeremy Bentham aufgezeigt. Der Brite war einer der wichtigsten Sozialreformer des 19. Jahrhunderts und Erfinder des sogenannten Panoptikums: Ein kreisförmiges Gefängnis, in dessen Mitte ein Überwachungsturm steht – von dort hat ein Wärter die Gefangenen alle im Blick. Die Zellen sind an ihrer Innen- und Außenseite offen, das einfallende Licht schafft absolute Transparenz.
Der Clou: Das panoptische System funktioniert auch ohne Wärter. Da sich die Insassen ständig beobachtet fühlen, verhalten sie sich jederzeit erwartungsgemäß: das Selbstzucht-und-Gehorsams-Ich regiert. Oder anders: Man wird perfekt trainiert, sich vor den Augen aller „gut zu benehmen“. Der französische Philosoph Michel Foucault führt das in „Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses“ (1975) weiter aus. Das Panoptikum ist quasi die Geburtsstätte totaler und damit auch digitaler Überwachung. Befördert von der Angst der Mächtigen vor Chaos und Unordnung. Der panoptische Mensch, also „derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus; er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung.“
Den Regierenden besonders willkommen: Die „verpestete Stadt“. Da sie, so Foucault, von „Hierarchie und Überwachung, von Blick und Schrift ganz durchdrungen ist“, sei sie die „Utopie der vollkommen regierten Stadt/Gesellschaft“. Deshalb „träumten die Regierenden vom Pestzustand, um die perfekten Disziplinen funktionieren zu lassen“. Die Pandemie-Zeit der vergangenen drei Jahre gab Zeugnis davon. Es ist davon auszugehen, dass es weitere Szenarien geben wird, um die erworbenen Kontrollmechanismen weiter zu etablieren.
Wer das nicht will, muss dagegen aufbegehren. Sonst wachen wir auch hierzulande im chinesischen Social-Credit-System auf. Es rückt immer näher.
Über den Autor

Sylvie-Sophie Schindler
Sylvie-Sophie Schindler, ist in Oberbayern aufgewachsen. Sie ist in Schauspiel, Philosophie und Pädagogik ausgebildet und hat weit über 1.500 Kinder auf ihrem Entwicklungsweg begleitet. Als Journalistin begann sie bei der Süddeutschen Zeitung, war jahrelang als Lokalreporterin für den Münchner Merkur tätig und belieferte Medien wie stern, VOGUE und GALORE mit ihren Texten. Zig tausend Artikel später orientierte sie sich im Journalismus neu, um frei und ohne Agenda schreiben zu können. Aktuell veröffentlicht sie unter anderem für die WELTWOCHE und Radio München. Sie ist Trägerin des Walter-Kempowski-Literaturpreises. Mit ihrem YouTube-Kanal DAS GRETCHEN will sie die Dialogbereitschaft stärken. In Vorträgen und in Netzwerken setzt sie sich für neue gesellschaftliche Wege ein, die auf Selbstorganisation, Herzoffenheit und freiem Denken gründen.