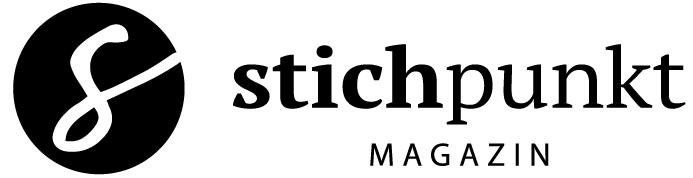Zugegeben, die sogenannte Realität entspricht nicht in jeder Hinsicht dem, was ich mir so vorstelle. In meiner idealen Welt gäbe es keine Kriege und keine Not; niemand müsste hungern, niemand wäre schwer erkrankt, niemand würde unterdrückt. Ein Ideal, das wohl die Mehrheit der Menschheit teilen dürfte. Das Weltgeschehen bringt mich, je nach Konfliktlage und eigener Verfasstheit, bisweilen an meine Grenzen. Dann spüre ich naive Fluchtreflexe. Nichts wie weg hier, nichts wie raus.
Natürlich ist das Illusion. Ich kann der Welt nicht entkommen, ganz einfach, weil ich in ihr lebe. Aber ich kann mich aus der Realität ausklinken, vor allem aus der Medienrealität. Keine Zeitungen, kein Fernsehen, kein Internet – so einfach geht es. Für mich finden weltweite Geschehnisse nur so lange statt, so lange ich mich über sie informiere. Natürlich ist dabei der Welt egal, ob ich über das Bescheid weiß, was in ihr abläuft – sie macht trotzdem weiter.
Die Entschlossenheit, abwesend zu sein, nicht erreichbar für die Welt, hat mich schon immer beeindruckt. Eremiten ziehen einfach ihr Ding durch. Manchmal auch nur für eine gewisse Zeit. Der französische Autor und Weltenbummler Sylvain Tesson hat sechs Monate in einer Neun-Quadratmeter-Hütte am russischen Baikalsee gelebt, fünf Tagesmärsche vom nächsten Dorf entfernt. Keine Nachbarn, keine Zugangsstraßen. Im Winter Temperaturen um die minus 30 Grad, im Sommer Bären an den Ufern. In dieser Wildnis schuf ich mir ein schlichtes und schönes Leben, ich machte die Erfahrung eines aus einfachen Handlungen bestehenden Daseins“, erzählt Sylvain Tesson in seinem Einsiedler-Tagebuch „In den Wäldern Sibiriens.“
Der Film „Märzengrund“, basierend auf einem Theaterstück von Felix Mitterer, erzählt die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte eines jungen Bauernsohnes, der sich gegenEnde der 1960er Jahre dagegen entscheidet, den Hof seiner Eltern zu übernehmen und sich stattdessen für ein radikal einsames Leben in die Berge zurückzieht. Irgendwann stellt sich die Frage, ob einer das überhaupt darf, ob er sich dem Weltgeschehen so rigoros enthalten darf. Ist das egoistisch? Haben wir nicht eine Weltverantwortung? Müssen wir uns nicht der Realität stellen? Andererseits, wer hat die Deutungshoheit über das, was Realität sei?
Als real gilt etwas, das keine Täuschung ist. Etwas, was sich zeigt, unabhängig von meinen Wünschen und Vorstellungen. Allein: Wie kann ich mir sicher sein, dass mich meine Wahrnehmung nicht täuscht? Wir sind in der Regel überzeugt, dass die Welt so ist, wie wir sie wahrnehmen. Immanuel Kant aber widerspricht dem. Ihm zufolge würden wir dieWirklichkeit nicht kennen, sondern nur unsere subjektive Interpretation davon – alles Wissen über die Welt entstehe denn aus einer trügerischen Sinneswahrnehmung des Menschen. Die Realität ist also keine äußere, sondern eine innere. Darauf verweist besonders offensichtlich der liebende Mensch wie etwa einst Rainer Maria Rilke in der „Siebenten Duineser Elegie“: „Nirgends, Geliebte, wird Welt sein, als innen“.
Können wir der Realität also entfliehen, wenn wir sie stets in uns selbst tragen? Die Frage ist wohl eher, welcher Realität wir uns zuwenden. Und wie wir in uns ausbilden die Fähigkeit umzugehen mit der von Peter Sloterdijk postulierten „Dialektik von Weltflucht und Weltsucht. Denn einerseits dürfte jeder Mensch den Wunsch kennen, nirgends mehr auffindbar zu sein und andererseits überall gleichzeitig sein zu wollen.
Es ist wie so oft eine Frage der Balance.
Über den Autor

Sylvie-Sophie Schindler
Sylvie-Sophie Schindler, ist in Oberbayern aufgewachsen. Sie ist in Schauspiel, Philosophie und Pädagogik ausgebildet und hat weit über 1.500 Kinder auf ihrem Entwicklungsweg begleitet. Als Journalistin begann sie bei der Süddeutschen Zeitung, war jahrelang als Lokalreporterin für den Münchner Merkur tätig und belieferte Medien wie stern, VOGUE und GALORE mit ihren Texten. Zig tausend Artikel später orientierte sie sich im Journalismus neu, um frei und ohne Agenda schreiben zu können. Aktuell veröffentlicht sie unter anderem für die WELTWOCHE und Radio München. Sie ist Trägerin des Walter-Kempowski-Literaturpreises. Mit ihrem YouTube-Kanal DAS GRETCHEN will sie die Dialogbereitschaft stärken. In Vorträgen und in Netzwerken setzt sie sich für neue gesellschaftliche Wege ein, die auf Selbstorganisation, Herzoffenheit und freiem Denken gründen.