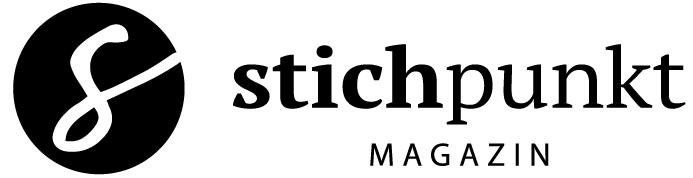Erwägungen über das genuin Menschliche in Bildungsprozessen
Fast alle 10-jährigen Schülerinnen und Schüler werden in Österreich seit zwei Jahren mit sogenannten digitalen Endgeräten ausgestattet, gegen einen Selbstbehalt von 25 Prozent; Einkommensschwache können davon befreit werden. 250 Millionen Euro wurden dafür von der Bundesregierung freigesetzt.
Natürlich regt man sich darüber nicht auf, wenn Material mehr oder weniger verschenkt wird (den Umweltaspekt „Elektroschrott“ möchte ich hier – wie gerade flächendeckend üblich – noch aussparen); es sei den SchülerInnen vergönnt, vor allem jenen, die sich dies sonst nicht leisten könnten.
Die anderen erweitern eben den bereits angehäuften häuslichen Bildschirmhaufen um ein weiteres Gerät.
Irritierend dabei ist, wie wenig über die Sinnhaftigkeit dieser Initiative gesprochen wird; falls man dies doch wagt, fühlt man sich nicht bloß rück-, sondern nahezu schon unanständig; den sich stetig wiederholenden Floskeln von „Schulen zukunftsfit machen“, „endlich im 21. Jahrhundert ankommen“ etc., wie sie einem aus dem Bildungsministerium und auch vielen Medien schon fast mantraartig entgegenschallen, kann sich niemand entziehen. Wer will schon, und sei das Wort noch so hässlich und inhaltsleer, NICHT als „zukunftsfit“ gelten?
Schließlich klingen die Verheißungen der frühen Digitalisierung auch verführerisch, wie auf der Plattform des Bildungsministeriums „Digitale Schule“ nachzulesen ist: „Richtig eingesetzt können die Möglichkeiten der Digitalisierung dazu beitragen, Neugierde, Lernfreude und nachhaltigen Lernerfolg bei Schülerinnen und Schülern zu fördern.“
Allerlei Sinnvolles kann man freilich mit iPads und Co. anstellen und anregen: Mit Lernapps wie „ANTON“ lässt sich autonom lernen, mit Quizzes können Unterrichtsstunden aufgelockert werden, Videos gedreht und geschnitten werden etc.
Dass der Einsatz von digitalen Geräten (abseits des Informatikunterrichts) irgendeinen positiven Effekt auf die Lernleistungen von SchülerInnen hätte, konnte bisher allerdings keine einzige Studie bestätigen; entweder kommt man zu dem Ergebnis, dass die Bildschirme gar keinen oder einen eher ungünstigen Einfluss auf das Lernen hätten (Stichwort: Ablenkung). Die Orientierung an Evidenzen wird aber, wenn es um Technologieeinsatz geht, häufig ausgespart; ich frage mich: warum? Und: Welche Tücken sind dem allgegenwärtigen Technikeinsatz inhärent?
Der Mensch als schambehaftetes Mängelwesen
Angesichts der unfassbaren Möglichkeiten der Technik stellt sich bei vielen Menschen wohl so etwas wie ein ständiger Minderwertigkeitskomplex ein: Was bin ich schon mit meinem kleinen Gehirn, meinen geringen Speicherkapazitäten, meinen Unpässlichkeiten, als dass ich einem Alleskönnergerät etwas entgegensetzen könnte oder möchte?
Gerade dem Berufsstand der Lehrenden wurde in den letzten Jahrzehnten das letzte Quäntchen Selbstbewusstsein geraubt (kontinuierliches Lehrerbashing seitens der Medien, Verschlechterung der Dienstverhältnisse, gesellschaftliche Entwertung einer erklärenden Funktion etc.), weswegen sich nur noch selten ein lehrendes Wesen an die Öffentlichkeit wagt, um Dinge in Frage zu stellen.
Im Umgang mit Technik scheint aber ohnehin kaum jemand ein souverän agierendes Subjekt zu sein, sondern eher ein Objekt, das sich dem gerade vorherrschenden technischen Imperativ fügt – zumindest so gut, als dass man nicht als potentiell altmodischer Querulant seine soziale Reputation zu verlieren droht.
Keiner hat das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine wohl eindrucksvoller beleuchtet als Günther Anders, der kritisierte, dass wir in diesem bereitwillig darauf verzichten, als Maßstab im Sinne Protagoras‘ zu fungieren: Wir passten uns den Geräten bis zur Selbsterniedrigung an1, der scheinbar ausweglose Charakter der Technik ließe dem Menschen nur die Möglichkeit „des Nachhumpelns“ hinter der von den Geräten durchdrungenen Welt.2
Der Zauber des neuesten Techno-Gadgets
Alle paar Jahre erliegen wir also dem zweifelhaften Charme der neuesten technischen Errungenschaft; vor über einem Jahrzehnt erlebte etwa die PowerPoint-Präsentation ihren Höhepunkt; jede Lehrperson, die etwas auf sich hielt, verarbeitete Unterrichtsinhalte in verdauliche Folien; SchülerInnen wurden dazu ermutigt oder gezwungen, ihre Referate damit zu veranschaulichen etc.
Im Nachhinein wirkt diese Euphorie, dieser Aktionismus („Das müssen wir jetzt tun, sonst…“ – ja was eigentlich?) immer ein bisschen rührend; wahrscheinlich weil mit diesen Errungenschaften stets die leise Hoffnung einhergeht, dass nun das Lehren und Lernen endlich einfacher und sogar besser funktionieren würde, diese Hoffnung aber immer wieder auf’s Neue enttäuscht wird: Lernen bleibt eine Anstrengung, für die man sich manchmal überwinden muss; und als LehrerIn muss man etwas zu sagen haben, sonst laufen alle Präsentationsmodi ins Leere.
Wenn ich SchülerInnen referieren lasse, muss ich sie vor allem darauf hinweisen, dass nicht die PowerPoint-Präsentation der Mittelpunkt ihres Vortrages ist, sondern sie selbst und das von ihnen Gesagte, dass sie Folien und darauf Geschriebenes nur minimalistisch einsetzen sollen, da ansonsten das Publikum und auch sie selbst davon zu sehr abgelenkt werden.
Die Versuchung, sich ein bisschen hinter dem Bildschirm zu verstecken, herumzuklicken, abzulesen ist riesig und verständlich – vor vielen Leuten zu sprechen ist nun einmal bei den meisten mit großen Ängsten verbunden.
Originell, erfrischend und geradezu mutig wirken SchülerInnen heute dann, wenn sie den Zauber des Augenblicks nutzen und während ihrer Präsentation z.B. etwas auf einem Flipchart-Blatt oder der Tafel entstehen lassen; etwas, das noch nicht fix und fertig vorbereitet ist.
Das Antiquierte wirkt modern: Ironie der Geschichte!
Die Absorbierung durch den Bildschirm
Jede Fachschaft musste sich im Rahmen des Digitalisierungsprozesses überlegen, wie die SchülerInnen nunmehr das iPad, den Laptop in Deutsch, in Mathmatik, in Englisch etc. sinnvoll nutzen könnten. Auf der Website des Ministeriums „Digitale Schule“ wird darauf hingewiesen, dass die Geräte nicht zum Selbstzweck werden sollten, der Einsatz müsse eben didaktisch Sinn ergeben.
Solange man selbst entscheiden kann, wann das Gerät eingesetzt wird und es ansonsten (bei Unterstufenschülern) in der Schultasche bleibt, ist an dem Projekt nichts auszusetzen; die Hoffnung, dass SchülerInnen durch digitales Lernen intelligenter oder gebildeter werden, wird sich aber wohl wieder als Irrglaube entpuppen (oder hegt diese Hoffnung ohnehin niemand?).
Sollten LehrerInnen den Einsatz überstrapazieren, ist sogar anzunehmen, dass Fähigkeitkeiten abnehmen werden – auf beiden Seiten. Analog zu manchen Eltern kann man schließlich auch als LehrerIn die Kinder mit Bildschirmen verlässlich „ruhigstellen“.
Lässt man sie googeln/recherchieren, an einem Lernprogramm arbeiten o.Ä., werden sie regelrecht absorbiert von den Bildschirmen; man kann sich einmal zurücklehnen.
Was aber letztlich entscheidend ist für einen Bildungsprozess, so meine Erfahrung, ist die direkte Interaktion zwischen LehrerIn und SchülerIn oder auch zwischen SchülerIn und SchülerIn.
Vor den Kindern Wissen redend zu kontextualisieren, sprich: inspirierenden Frontalunterricht zu halten (das böse Wort ist gefallen!), ist ungleich schwerer und aufwändiger, als sie dazu aufzufordern, irgendetwas am Gerät herumzudaddeln.
Gespräche mit ihnen zu führen, gemeinsam zu diskutieren – das kann man, glücklicherweise, nicht an einen Bildschirm delegieren.
Wohin geringer Menschenkontakt – etwa durch Schulschließungen in Coronazeiten – geführt hat, sieht man ja, by the way, nun auch an der Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die psychologische Betreuung benötigen. Eigentlich ist „distance learning“ grandios gescheitert, niemand will mehr etwas von einer „Zoom“-Sitzung oder Ähnlichem wissen; es funktioniert zwar in technischer Hinsicht (naja, meistens), nicht aber in psychologischer.
Oder wie ein 11-jähriger Schüler von mir verzweifelt bekundete: „Wenn der Lockdown noch einen Tag länger gedauert hätte, wäre ich verrückt geworden!“
Also schicken wir die Kinder auch nebeneinander sitzend nicht allzu oft ins digitale Exil.
Reduktion und Konzentration
SchülerInnen vor eingeschalteten und nicht limitierten iPads und Co. erfolgreich zu unterrichten, ist selbstredend ein ziemlich frustrierendes, ja, unmögliches Unterfangen, weil sie so vielen Ablenkungsoptionen ausgesetzt sind (Spiele, Chatten, Serien plus earpod, Schnappschüsse schießen etc.), denen sich nicht nur SchülerInnen nicht entziehen können.
Will man konzentriert mit ihnen arbeiten, muss man sie entschlossen bitten, ihre Geräte zu schließen – was von den Oberstufenschülern ziemlich konsequent mit enerviertem Augenverdrehen quittiert wird.
Dies gilt es aber auszuhalten, wenn einem auch ihre geistige Anwesenheit und eine gewisse Lebendigkeit etwas bedeuten.
Zum Denken benötigt man keinen Strom, kein Tool; im Gegenteil, am besten gelingt es meist, je reduzierter die Umgebung ist, je weniger man von blinkendem Schnickschnack umgeben ist.
Und selbstständiges Denken wird umso wichtiger, je mehr Möglichkeiten es gibt, es scheinbar zu delegieren (an Google, an ChatGPT etc.) – es sei denn, wir geben den Anspruch, eine Sache verstehen zu wollen, als Gesellschaft endgültig auf und begnügen uns zeitlebens mit dem bloßen Abrufen von Infos.3
Unterstützen Sie das Stichpunkt Magazin
- Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen I. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. München: Beck 1994, S. 47. [↩]
- Ebd., S. 16.[↩]
- Ein Dank an meinen ehemaligen Philosophieprofessor Dr. Konrad Paul Liessmann, der konsequent auf diesen Unterschied verwies. Z.B. in „Konrad Paul Liessmann: Geisterstunde. Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift. Wien: Zsolnay 2014, S. 55.“[↩]
Über den Autor
Die im Bezirk Grieskirchen aufgewachsene Autorin studierte Germanistik, Philosophie und Psychologie in Wien und verfasste 2006 ihre Abschlussarbeit über Kants Morallehre. Seit rund 15 Jahren unterrichtet sie an einer Linzer AHS Deutsch, Psychologie und Philosophie. Während ihrer einjährigen Bildungskarenz begann sie 2014 Italienisch zu studieren, belegte weitere Philosophievorlesungen und arbeitete u.a. einige Monate in einer Jugendherberge in Süditalien.
Es waren vor allem die Corona-Krise und ihre Auswüchse, die sie dazu veranlassten, ihre schreiberische Tätigkeit zu forcieren: In „Die Presse“ wurden drei maßnahmenkritische Artikel von ihr veröffentlicht („Aspekte des Unbehagens“).