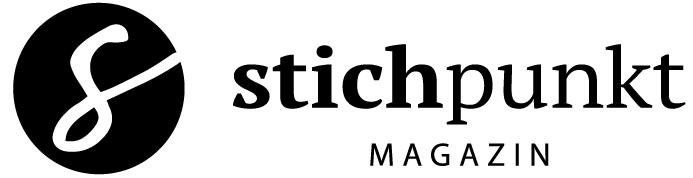Irgendwo in der Waldeinsamkeit Russlands, am Rande einer Schlucht vergraben, soll er liegen, der grüne Stock. Würde er gefunden, so wäre es das Ende aller Menschheitsqualen. Keine Kriege mehr, keine Krankheiten. Stattdessen immerwährendes Glück. Dieses Märchen, einst erzählt von dessen ältestem Bruder Nikolai, gehört zu den prägendsten Kindheitserinnerungen Lew Nikolajewitsch Tolstois. Das Sujet taucht in einem seiner späten Aufsätze wieder auf, worin der große russische Schriftsteller bekennt, sein ganzes Leben sei im Grunde der Suche nach dem grünen Stock gewidmet gewesen, angetrieben von der Frage, wo das Glück für die Menschheit zu finden sei. Gleichwohl gehe es nicht darum, es zu finden, sondern das Suchen nie aufzugeben.
Nun müsste man sich, um nicht im Schwammigen zu verharren, an einer Definition versuchen. Mit Jean-Jacques Rousseau gesprochen: „Jeder Mensch will glücklich werden; um aber das Ziel zu erreichen, müsste er zunächst wissen, was das Glück eigentlich sei.“ Man stelle sich eine Wiese vor, hohes Gras, es riecht nach Sommer. In ihrer Weite, in sonnenverwobener Atmosphäre, stehen mehrere Männer, die Hand an der Sense, ins Mähen versunken, bis hin zur Selbstvergessenheit. Der Gutsbesitzer Konstantin Lewin ist einer von ihnen. Und diese Erfahrung verwandelt ihn; er erlebt, je länger er sich seiner Tätigkeit hingibt, die mehr Sein ist als Tun, seine glücklichsten Momente.
Wer die entsprechende Passage aus Tolstois „Anna Karenina“ gelesen hat, dem wird sie, ob der eindrucksvollen Schilderung, noch lange nachhallen. Die innerseelische Metamorphose des Konstantin Lewin: Er hat nicht danach gesucht, sie hat sich ihm ereignet. Wäre daraus zu folgern, dass wir das Glück verfehlen, wenn wir denken, es sei machbar? Inwiefern können wir es in ein Kontinuum überführen? Ist Glück überhaupt auf Dauer angelegt? Oder ist ihm wesenhaft, dass es zerrinnt?
Das übrigens ist typisch. Zu den Risiken und Nebenwirkungen der Lektüre von „Anna Karenina“ gehört, dass man existenziellen Fragen nichtausweichen kann. Ungeeignet also für alle, die eine Allergie gegen Selbstreflexion haben und einbetoniert sind in ihrer eingebildeten Unerschütterlichkeit. Oder anders gesagt: Literatur kann erschüttern und hinaustreiben aus dem gewohnten Denken. Ist es doch ohnehin ein Wesensmerkmal weltliterarischer Werke, dass sie inspirieren zu mal verborgenem, mal offensichtlichem Gedankenkreisen, angefangen von „Wie soll man leben?“ bis hin zu „Wie muss man sterben?“.
Reicht das aber schon, um Frieden zu schaffen? Denn das ist die These, dass die Literatur die Kraft hat, zumindest zum Frieden beizutragen. Es ist doch so: Wenn wir wieder mehr Bereitschaft haben, uns den Fragen zuzuwenden, und genau dazu kann gute Literatur inspirieren, dann entsteht automatisch mehr Offenheit. Und dann lassen wir uns nicht mehr abfertigen mit Phrasen, die in Politik und Medien vorgegeben werden. Und die in diesen Zeiten vor allem der Propaganda von Krieg dienen, verknüpft mit dem Hinweis, es dürfe nichts hinterfragt werden.
Wer aber nichts hinterfragt, der handelt intellektuell unredlich. So auch der, der bei Kriegen Vorgeschichten ausblendet und sich mit nur einer Sicht auf die Dinge beschränkt und damit der anderen Seite Verständnis und Empathie verweigert.
Um sich auf einen anderen zuzubewegen, braucht es die Frage, das Interesse, die Neugier – dann bricht etwas auf. Anders gesagt: Der Frieden braucht die, die sich nicht mund- und denktot machen lassen.
Das zaristische Russland Mitte des 19. Jahrhunderts, in das „Anna Kareninas“ Schicksal eingebettet ist, erlebte Unruhen, Umbrüche und Reformbemühungen. Nur wenige Jahrzehnte später begann der Erste Weltkrieg. Dann kam der Zweite. Und heute? Manche sagen, wir stünden längst in einem Dritten Weltkrieg.
Literatur statt Waffen. Auch das wäre ein Anfang.
Über den Autor

Sylvie-Sophie Schindler
Sylvie-Sophie Schindler, ist in Oberbayern aufgewachsen. Sie ist in Schauspiel, Philosophie und Pädagogik ausgebildet und hat weit über 1.500 Kinder auf ihrem Entwicklungsweg begleitet. Als Journalistin begann sie bei der Süddeutschen Zeitung, war jahrelang als Lokalreporterin für den Münchner Merkur tätig und belieferte Medien wie stern, VOGUE und GALORE mit ihren Texten. Zig tausend Artikel später orientierte sie sich im Journalismus neu, um frei und ohne Agenda schreiben zu können. Aktuell veröffentlicht sie unter anderem für die WELTWOCHE und Radio München. Sie ist Trägerin des Walter-Kempowski-Literaturpreises. Mit ihrem YouTube-Kanal DAS GRETCHEN will sie die Dialogbereitschaft stärken. In Vorträgen und in Netzwerken setzt sie sich für neue gesellschaftliche Wege ein, die auf Selbstorganisation, Herzoffenheit und freiem Denken gründen.