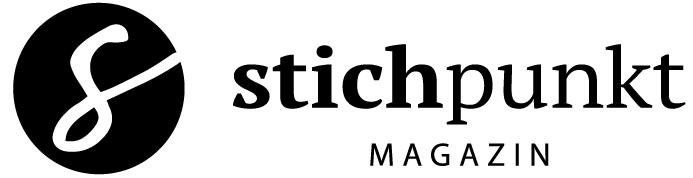Meinungen werden unterdrückt, die Demokratie ist gefährdet. Es braucht mehr denn je Menschen, die sich der Masse entgegenstellen. Ein Plädoyer für das Außenseitertum.
Lautes Lachen. Jonathan Meese rennt mit einem Plastik-Laserschwert durch sein Berliner Atelier. Im nächsten Moment klettert er auf eine Leiter und spannt einen transparenten Mädchenschirm über sich aus. Ausgelassen fuchtelt er damit herum – und verletzt sich schließlich an der Stirn. Blut tropft. Wieder lautes Lachen. Jonathan Meese schaut mich übermütig an, während er mit einem Taschentuch über seine Stirn tupft und sagt: „Wir können beginnen.“ Das ist nun gut drei Jahre her. Ich traf den bekannten Maler, um ihn für das Magazin „Galore“ zu interviewen.
Jonathan Meese gilt als Enfant terrible. Er selbst bezeichnet sich als „Spielkind“. Oder als „Seewolf“. Manchmal auch als „Robinson Crusoe“. Auf einer Insel alleine sein Ding durchzuziehen, das sei genau das Richtige. Überhaupt möge er, wie er mir erzählte, alle Einzelgänger, „die hart am Sturm segeln.“ Er kenne das, er sei immer isoliert gewesen, von Kindheit an. Kann man sich daran gewöhnen? Lieber alleine sein und nicht bei den anderen? Sind die anderen nicht ohnehin die Hölle, wie es bei Jean-Paul Sartre heißt? „Ich habe die Riesenschwäche, dass ich mich in Menschenmassen sauunwohl fühle.“ Er ist also gerne Außenseiter? „Es ist überhaupt nicht schlimm, nicht dazuzugehören“, versicherte mir Jonathan Meese. Und: „Man muss den Kindern heutzutage sagen, dass es eine Stärke ist, ein Außenseiter zu sein.“ Das mag sich wie eine Provokation anhören. Wer will schon am Rande stehen? Womöglich noch schief angesehen und ausgelacht, schlimmstenfalls gemobbt. Wollen wir denn nicht alle dazugehören? Dass der Mensch ein soziales Wesen ist, zeigt sich bereits nach der Geburt. Babys, die keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, können nicht überleben. Wir sind auf Zuwendung angewiesen, auf Versorgung, auf Bejahung durch andere. Durch die Interaktion mit anderen Menschen können wir nach und nach besser verstehen, wer wir sind, wie wir uns von anderen unterscheiden und wo in der Welt wir unseren Platz haben. Trotzdem, was kann man gewinnen, wenn man am Rande steht? Nochmal Jonathan Meese: „Als Zwölfjähriger sah ich aus wie acht. Deshalb durfte ich bei vielen Dingen nicht mitmachen. Mir wurde das als Schwäche verkauft.“ Heute wisse er, es sei eine Stärke: „Dass du merkwürdig bist, dass du größer bist oder kleiner, ist doch alles super. Man muss nicht überall mitmachen.“ Daher sei sein Motto: „Sei ein Einzelner. Sei mal nicht dabei.“ Ein Dasein also jenseits des Gleichschritts, jenseits der Masse. Und damit in Unabhängigkeit. Oder so gesagt: Wer schon draußen ist, muss sich keine Sorgen machen, ausgeschlossen zu werden. Die Drohkulisse der sozialen Verbannung fällt weg.
Von dieser Position aus scheint es plötzlich ganz leicht: Man spricht das aus, was andere, weil sie den Ausschluss fürchten, nicht auszusprechen wagen. Man geht in den Widerstand, man stellt sich quer, wo andere im Trott marschieren. Man leistet also: Ungehorsam. Wozu im Grunde jeder, so sieht es die Philosophin Hannah Arendt, verpflichtet ist. Und brauchen wir ihn nicht gerade jetzt besonders dringend? Es ist eine Zeit voller Umbrüche, es gibt Entwicklungen, die besorgniserregend sind, Ideologien breiten sich krakenartig aus und scheinen nach allen greifen zu wollen, im Internet strömen permanent Hetzmeuten gegen unliebsame Meinungen aus. Es ist alarmierend, dass immer mehr Menschen überzeugt sind, „man darf das nicht sagen”.
Die Demokratie ist gefährdeter denn je. Sie war noch nie ein Selbstläufer, doch weil viele sich der Illusion hingegeben haben, sie sei es, steht sie nun derart vernachlässigt da, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, um sie zu retten. Wer daran interessiert ist, muss die Angst überwinden, aus der Masse herauszufallen. Er muss also letztlich aufgeben, von allen geliebt werden zu wollen. Denn: Wer unbedingt Anerkennung braucht, fällt automatisch in den Chor der Social-Media-Klone ein, anstatt eine Revolution anzuzetteln. Gemäß des athenischen Staatsmanns Solon sei der Mensch in der Gruppe entweder „dumm wie die Schafe oder gefährlich wie die Raubtiere“. Nur die Einzelnen seien als „schlaue Füchse“ zu loben.
Man kann es drehen und wenden, wie man will: Es kann keine bessere Prävention gegen Diktatur geben als die Bereitschaft zum Außenseitertum. Erst dadurch werden Debatten wieder mutiger beziehungsweise zu dem, was im Eigentlichen eine Debatte ausmacht: Rede und Gegenrede. Das Außenseitertum ist der notwendige Gegenentwurf in einer Zeit, in der es nur noch darum zu gehen scheint, wie man sich möglichst viel Zustimmung und Applaus sichern kann. Das Skandieren der „richtigen“ Parole, das Hissen der „richtigen“ Fahne, das Tragen der „richtigen“ Armbinde ist dann unabdingbar, um im gesellschaftlichen Überlebenskampf zu bestehen. Nur darf nicht übersehen werden: Das kann sich tagesaktuell ändern, je nachdem, wohin die Mehrheit „trendet“. Es handelt sich also nicht um tatsächliche Überzeugungen, sondern um ein temporäres Phänomen, um Moden. Man bedenke: Wer für nichts steht, fällt für alles.
Als Immanuel Kant im Jahre 1784 die lateinische Losung „Sapere aude“ zum Leitspruch der Aufklärung erklärte, vergaß er, darauf hinzuweisen, dass jeder, der den Mut aufbringt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, sich unbedingt zum Alleinsein befähigen muss. Um eigenständige Gedanken zu entwickeln, muss der Mensch erst mal zu sich selbst kommen, sich ganz auf sich einlassen, fernab anderer Urteile und Meinungen. „Wer die letzte Einsamkeit kennt, kennt die letzten Dinge“, schrieb Friedrich Nietzsche, der selbst sehr zurückgezogen lebte. Für den philosophierenden Sonderling war die Einsamkeit der einzige Weg, um tiefe Erkenntnis zu erlangen.
Weitere Nebeneffekte lassen sich aus einem Gedanken Martin Heideggers ableiten: „Die Masse enthemmt, macht aber nicht frei, denn in ihr ist jeder wie der andere und keiner er selbst.“ Frei ist also der, der aus dem Kollektiv heraustritt. Und nur wer frei ist, kann zu sich selbst kommen. Vielleicht auch so: Wer zu sich selbst kommt, wird frei. Er lässt sich nicht von gesellschaftlichen Normen unterdrücken und zu einer Einheitsfigur abrichten. Sondern kann ein der inneren Bestimmung gemäßes Leben führen. Was macht es schon aus, alleine dazustehen? Natürlich, es ist ein Unterschied, ob man sich ganz bewusst für das Außenseitertum entscheidet oder ob man unfreiwillig in diese Position gerät. Sogenannte existentielle Außenseiter leiden meist unter ihrer Situation. Intentionelle Außenseiter hingegen brechen bewusst Regeln, hinterfragen das Bestehende und wollen die Norm hinter sich lassen. So oder so, zu beschönigen gibt es nichts. Der Einzelne spürt oft den rauen Wind. Trotzdem, und das mag Trost geben, ist er in guter Gesellschaft: Alle großen Geister, alle Menschen, die Geschichte gemacht haben, weisen, mal mehr, mal weniger, Merkmale des Typus‘ Außenseiter auf. Um ein Einzelner zu werden, ist es nie zu spät. Und sei es nur zum passenden Zeitpunkt am passenden Ort.
Über den Autor

Sylvie-Sophie Schindler
Sylvie-Sophie Schindler, ist in Oberbayern aufgewachsen. Sie ist in Schauspiel, Philosophie und Pädagogik ausgebildet und hat weit über 1.500 Kinder auf ihrem Entwicklungsweg begleitet. Als Journalistin begann sie bei der Süddeutschen Zeitung, war jahrelang als Lokalreporterin für den Münchner Merkur tätig und belieferte Medien wie stern, VOGUE und GALORE mit ihren Texten. Zig tausend Artikel später orientierte sie sich im Journalismus neu, um frei und ohne Agenda schreiben zu können. Aktuell veröffentlicht sie unter anderem für die WELTWOCHE und Radio München. Sie ist Trägerin des Walter-Kempowski-Literaturpreises. Mit ihrem YouTube-Kanal DAS GRETCHEN will sie die Dialogbereitschaft stärken. In Vorträgen und in Netzwerken setzt sie sich für neue gesellschaftliche Wege ein, die auf Selbstorganisation, Herzoffenheit und freiem Denken gründen.