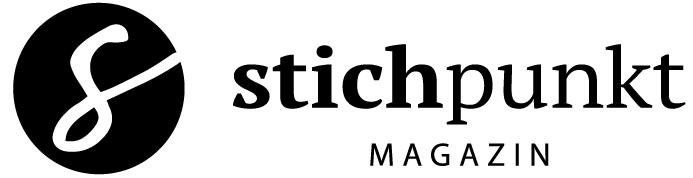Immer mehr Menschen schalten den Fernseher ab, wenn gegendert wird. Zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich mit anderen im Austausch bin. Gestern erzählte eine Frau, die ich im Bioladen traf, sie habe eine Dokumentation, auf die sie sich sehr gefreut habe, nach wenigen Minuten abschalten müssen; das Gendern des Sprechers habe sie extrem genervt. Ein Freund meidet das öffentlich-rechtliche Programm inzwischen grundsätzlich, weil er, wie er sagt, allergisch sei gegen die „allgegenwärtige Sprachverstümmelung der Geschlechtsfanatiker“.
Gegen eine Reduzierung des Fernsehkonsums ist grundsätzlich nichts einzuwenden, im Gegenteil. Schließlich hat das weitere erhebliche Vorteile, etwa dass man sich dadurch auch von polit-medialer Propaganda einigermaßen abkoppelt. Trotzdem ist damit noch nicht alles getan, um dem grassierenden Sprach-Virus, das sich längst pandemisch ausgebreitet hat, zu entkommen. Auch Zeitschriften und Zeitungen machen mit, auch Autoren und Verlage, und auch auf Konferenzen und bei Vorträgen, allen voran an Universitäten, werden Sternchen oder Unterstriche gesetzt beziehungsweise unnatürliche Pausen eingelegt, die den Eindruck hinterlassen als hätte der Sprecher sekundenphasenweise kognitive Aussetzer.
Was soll das eigentlich? Ein nicht unerheblicher Teil der Gesellschaft ist besonders besessen davon, ständig zu demonstrieren, auf der – angeblich – „guten Seite“ zu stehen. Man kauft Biotomaten, fährt Lastenfahrrad – und gendert. Ob die Welt dadurch, wie von den Akteuren behauptet wird, besser wird, ist fraglich. Unbestritten aber dürfte sein, dass sie sich selbst gut damit fühlen. Hand aufs Herz: Ist das nicht der eigentliche Grund?
Es heißt zwar, man wolle via Gendern alle Geschlechter sprachlich „sichtbar machen“, niemanden diskriminieren und so weiter, aber tatsächlich beschleicht einen das Gefühl, es gehe zuallererst darum, zu zeigen, dass man in der moralischen A-Liga mitspielt. Das poliert das eigene Selbstbild natürlich erheblich auf. Und bedeutet in der Konsequenz, dass Gendern zuallererst der narzisstischen Selbstbefriedigung dient.
Zum anderen wird auch deshalb mitgemacht, weil es eben viele machen. Man kennt das aus Corona-Zeiten, bloß nicht ausscheren, sich immer so verhalten, dass man der Anerkennung anderer sicher sein kann. Und bloß nichts tun, was einen in den Verdacht bringt, zu den Abtrünnigen zu gehören. In gewissen, besonders in linksgrünen und akademischen Kreisen, ist das Gendern zum Sprachcode dafür geworden, wo man politisch steht. Geschlechtergerechtigkeit? „Mir egal“, vertraute mir vor einiger Zeit eine PR-Mitarbeiterin eines Unternehmens an. Sie gendere nur, um nicht aufzufallen. Auch hier wird deutlich: Man will sich selbst retten, nicht andere.
Und wer rettet die Sprache? Der Schriftsteller Uwe Tellkamp erkannte sehr richtig, Gendern sei „eine Vergewaltigung von Sprache“. Man müsse, wie er im Oktober 2022 bei einer Lesung in Neubrandenburg erklärte, die Sprache als „tausendstimmige Orgel“ verstehen. Würde man zwei Register der Orgel wegnehmen, weil diese „irgendwie kolonial belastet“ seien, dann klinge die Orgel nicht mehr. So sei es, wenn gegendert werde. Auch Dieter Hallervorden ist, wie er in mehreren Interviews deutlich machte, ein Gender-Gegner – so wie übrigens der überwiegende Teil der Bevölkerung. Sprache sei, so der Komiker, nun mal „nicht von oben herab zu diktieren“, das habe es „einmal von den Nazis und einmal von den Kommunisten“ gegeben, und es habe nur temporär und unter großem Druck funktioniert.
Wollen wir etwa wieder dahin schlittern?
Daher: Gendern – nein, danke.
Über den Autor

Sylvie-Sophie Schindler
Sylvie-Sophie Schindler, ist in Oberbayern aufgewachsen. Sie ist in Schauspiel, Philosophie und Pädagogik ausgebildet und hat weit über 1.500 Kinder auf ihrem Entwicklungsweg begleitet. Als Journalistin begann sie bei der Süddeutschen Zeitung, war jahrelang als Lokalreporterin für den Münchner Merkur tätig und belieferte Medien wie stern, VOGUE und GALORE mit ihren Texten. Zig tausend Artikel später orientierte sie sich im Journalismus neu, um frei und ohne Agenda schreiben zu können. Aktuell veröffentlicht sie unter anderem für die WELTWOCHE und Radio München. Sie ist Trägerin des Walter-Kempowski-Literaturpreises. Mit ihrem YouTube-Kanal DAS GRETCHEN will sie die Dialogbereitschaft stärken. In Vorträgen und in Netzwerken setzt sie sich für neue gesellschaftliche Wege ein, die auf Selbstorganisation, Herzoffenheit und freiem Denken gründen.